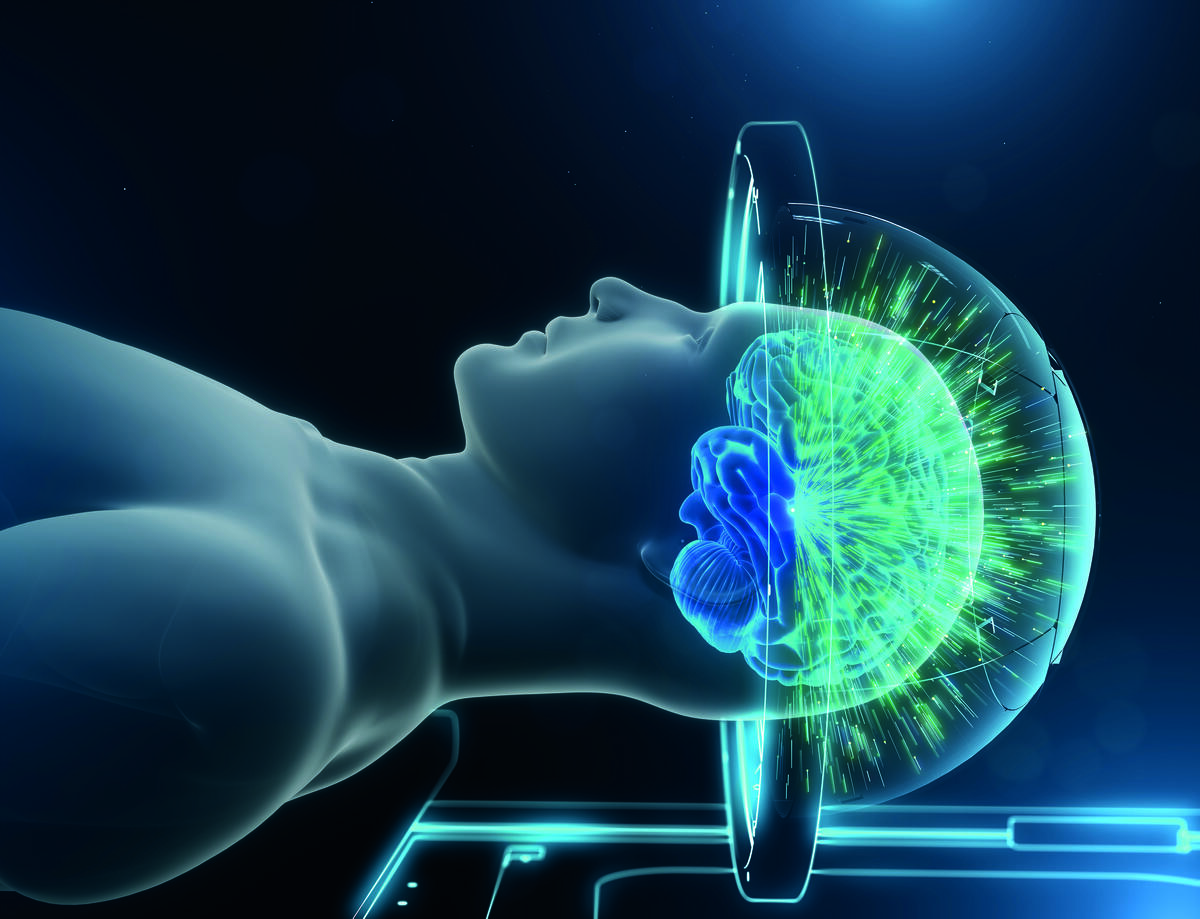
Bessere Diagnose ermöglicht frühe Therapie
Eine frühe Diagnosestellung ist wichtig, um den Betroffenen Sicherheit zu geben, wie erste motorische und vor allem auch nicht-motorische Symptome einzuordnen sind, und diese bestmöglich zu therapieren. Und um nervenzellschützende Therapien zu entwickeln, die zu einem Zeitpunkt gegeben werden können, in dem noch möglichst wenige Nervenzellen zugrunde gegangen sind“, erklärt Prof. Daniela Berg, Leiterin der Klinik für Neurologie am UKSH, Campus Kiel.
Morbus Parkinson ist eine chronisch-degenerative Nervenerkrankung, von der aktuellen Schätzungen zufolge in Deutschland rund 400.000 meist ältere Frauen und Männer betroffen sind und deren Häufigkeit weltweit zunimmt. Die Erkrankung schreitet zum Zeitpunkt des Auftretens klinischer Symptome meist bereits seit Jahren oder gar Jahrzehnten voran, unspezifische Symptome wie gastrointestinale Störungen, ungewohnte Müdigkeit, häufige Rückenschmerzen und olfaktorischen Beeinträchtigungen – die meisten Parkinson-Kranken können das Pizzagewürz Oregano nicht riechen – stehen zunächst im Vordergrund. Sie werden von den Beteiligten häufig bagatellisiert und fehlgedeutet. Auch kognitive Störungen bis zur Demenz und psychiatrische Störungen wie Depressionen und Halluzinationen sowie Schlafstörungen können Indizien sein, wobei sich kognitive und psychiatrische Störungen auch wechselseitig beeinflussen können. Meist rückt eine Parkinson-Erkrankung jedoch erst dann ins Blickfeld, wenn die Schrittlänge kürzer und die Schrift kleiner wird.
Frühe Diagnose durch Biomarker
Dabei könnte mit den vielfältigen neuen Diagnosemethoden sowie den im Labor gewonnenen Erkenntnissen eine frühzeitigere Diagnose gestellt werden, glaubt Prof. Claudia Trenkwalder aus Kassel. So wurden in den vergangenen zehn Jahren zahlreiche Biomarker entdeckt, die eine frühe Diagnose der Parkinson-Erkrankung ermöglichen. „Neben liquorbasierten Biomarkern werden derzeit auch andere Kandidaten aus Blutproben, Haut und anderen Geweben erforscht, um die diagnostischen Möglichkeiten zur Früherkennung von Parkinson weiter auszubauen“, erläutert Trenkwalder.
So hat eine Kieler Arbeitsgruppe unter Leitung von Prof. Berg einen biochemischen blutbasierten Test entwickelt, mit dessen Hilfe 30 getestete Parkinsonpatienten mit hoher Sensitivität von 50 Kontrollpersonen unterschieden werden konnte (https://doi.org/10.1093/brain/awac115). Berg wies auch auf eine weitere diagnostische Möglichkeit hin: Mittels transkranieller Sonografie lassen sich seit einiger Zeit Besonderheiten in der Substantia nigra sichtbar machen. Bei der Substantia nigra handelt es sich um eine tief im Mittelhirn gelegene schmetterlingsförmige Region, deren Zellen den Botenstoff Dopamin bilden – eine Vorläufersubstanz der Hormone Adrenalin und Noradrenalin, die eine zentrale Rolle für die Kontrolle von Bewegungen spielt. Fehlt der Neurotransmitter Dopamin oder tritt ein Mangel auf, werden die Nervenzellen der benachbarten Hirnregion, dem Striatum, nicht ausreichend stimuliert. Daraufhin kommt es zu einer Verlangsamung willkürlicher und unwillkürlicher Bewegungen bis hin zur Akinese. Ein damit verbundenes Übergewicht anderer Botenstoffe wie Acetylcholin und Glutamat führen zum Parkinson-typischen Tremor und zur Muskelsteifheit (Rigor). Bis zur Diagnosestellung sind bereits mehr als die Hälfte der Neuronen in der „schwarzen Substanz“ abgestorben; das Gehirn kann diese Ausfälle in der sogenannten Prodromalphase aber so gut kompensieren, dass die auf den Zellverlust folgende Symptomatik nicht früher sichtbar wird.
Bei der transkraniellen Sonografie wird mit einem hochauflösenden Ultraschallgerät durch den Schläfenknochen das Gehirn dargestellt. Der anatomische Bereich der Substantia nigra präsentiert sich hierbei im Krankheitsfall hell und vergrößert – ein Befund, „der bis heute als Hyperechogenität der Substantia nigra bezeichnet wird und der bei über 90 % der Parkinson-Patienten nachzuweisen ist“, so Berg. Tierexperimentelle Untersuchungen und Untersuchungen an Gehirnen von Verstorbenen hätten in der Folge gezeigt, dass diese Ultraschallauffälligkeit mit einem vermehrten Eisengehalt und aktivierten Entzündungszellen in diesem Zellkerngebiet verbunden ist – ein Befund, der für Parkinson schon lange vorher beschrieben worden sei, aber bildgebend bislang nicht einfach dargestellt werden konnte.
„Die Möglichkeit, mit einer verhältnismäßig einfachen, kostengünstigen, nebenwirkungsfreien und auch bei körperlich unruhigen Patienten einsetzbaren Methode einen für die Diagnose so hilfreichen Befund zu erheben, hat dazu geführt, dass die transkranielle Sonografie mittlerweile in Zentren der ganzen Welt eingesetzt wird“, so Berg. Auch für die Forschung habe die Ultraschalluntersuchung erhebliche Bedeutung: „Für den Einsatz der aktuell in Entwicklung befindlichen Medikamente, die ursächlich in den Krankheitsprozess eingreifen und somit so früh wie möglich eingesetzt werden sollen, kann die mittels transkranieller Sonografie erhobene Hyperechogenität der Substantia nigra ein wichtiges Kriterium darstellen“, erläuterte Berg.
Was den massiven Zelluntergang letztendlich verursacht, ist bis heute nicht in allen Details bekannt; aufhalten lässt er sich offensichtlich nicht. Die Symptomatik wird medikamentös kontrolliert; im fortgeschrittenen Stadium – wenn sich das Zittern verstärkt und letztlich unkontrollierbar wird – ist bislang ein operativer Eingriff mit der Implantation von Elektroden ins Gehirn die einzige Option. Die sogenannte Tiefe Hirnstimulation stoppt oder lindert bei vielen Parkinson-Patienten den Tremor; gleichwohl handelt es sich bei der Einbringung der Elektroden und des Impulsgebers um einen operativen Eingriff mit entsprechenden Risiken.
Fokussierter Ultraschall als Option
Weniger invasiv ist ein Ultraschallverfahren, das die Wellen in ein definiertes Hirnareal schickt und auf diese Weise einen Tremor bekämpft. „Mit dem Magnetresonanz-gesteuerten fokussierten Ultraschall steht jetzt eine schonendere Therapieoption zur Verfügung“, sagte Dr. Steffen Paschen, ebenfalls aus der Kieler Neurologie. Bei der Behandlung wird den Betroffenen eine Art Helm mit 1.024 Ultraschallquellen auf den Kopf gesetzt. Im Thalamus – einem Knotenpunkt im Gehirn bei Zittererkrankungen – werden die aus allen Richtungen eintreffenden Ultraschallwellen in Wärme umgewandelt und veröden das dort liegende Gewebe. „Dabei bleibt der Schädel intakt und auch umliegendes Gewebe und Blutgefäße werden nicht in Mitleidenschaft gezogen“, betonte der Oberarzt.
Vor der Behandlung wird die Knochenstruktur des Schädels mittels Computertomografie bestimmt und das Zielgebiet mittels MRT festgelegt. Der Kopf des Patienten wird rasiert, um Hautverbrennungen durch eingeschlossene Luftbläschen zu vermeiden und unter den Haaren verborgene Narben auf der Kopfhaut zu erkennen. Er ist in einem stereotaktischen Rahmen fixiert; die präzise Ausrichtung erfolgt über eine submillimetergenaue elektronische Steuerung.
Behandlung in drei Phasen
„Während des Eingriffs ist der Patient unter Überwachung der Vitalfunktionen bei vollem Bewusstsein“, erläutert Paschen. „Unterstützend können Medikamente zur Beruhigung, neurologischen Symptomkontrolle oder gegen Schmerzen appliziert werden.“ Die Behandlung erfolge in drei Phasen: In Phase eins wird zunächst die Übereinstimmung des gewählten Zielbereichs mit dem tatsächlich erwärmten Bereich bei geringer Energiezufuhr überprüft. In Phase zwei findet eine Temperaturerhöhung auf
47 – 50 °C statt, wodurch der Effekt und mögliche Nebenwirkungen abgeschätzt werden können, noch bevor eine Narbe gesetzt wird. „In der dritten Phase erfolgt die eigentliche Thermoablation, in der über 20 Sekunden eine Temperatur von 57 – 60 °C im Zielbereich erzeugt wird.“ Insgesamt dauert die Behandlung drei bis vier Stunden und der Therapieerfolg sei unmittelbar sichtbar, so Paschen. „Die Patienten sind nach der Behandlung sofort wieder mobilisierbar und können die Klinik nach den notwendigen klinischen Kontrollen nach zwei bis drei Tagen wieder verlassen.“
Mögliche Nebenwirkungen wie Gangstörungen, verwaschene Sprache und Taubheit seien mild und in der Folgezeit rückläufig, es komme zu einer 80- bis 90-prozentigen Tremorreduktion. Aktuell wird das Verfahren nur einseitig angewendet, sodass der Tremor auch nur auf einer Körperseite reduziert werde. In Studien wird derzeit auch die beidseitige Anwendung untersucht, Daten liegen jedoch noch nicht vor. Weltweit sind Paschen zufolge mehr als 4.000 Patienten mit dem Ultraschallverfahren behandelt worden, Langzeitdaten über fünf Jahre zeigen einen anhaltenden Therapieeffekt. In Deutschland wird diese Behandlung laut DEGUM derzeit in Bonn, Kassel und Kiel angeboten.
Text: Uwe Groenewold
